Die Periduralanästhesie (PDA) ist in der Geburtshilfe ein bewährtes Verfahren zur Schmerzlinderung. Doch so routiniert sie auch eingesetzt wird, so birgt sie doch Risiken, die bei fehlerhafter Durchführung dieser Anästhesie schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben können, von einer Duraperforation bis hin zu einer Querschnittslähmung. Treten Komplikationen auf und bleiben sie unerkannt oder werden zu spät behandelt, kann dies nicht nur medizinisch, sondern auch haftungsrechtlich relevant sein.
PDA bei der Geburt: sicher, aber nicht risikolos
Medizinisch gilt die PDA als grundsätzlich sicheres Verfahren. Sie wird in der Regel von Anästhesistinnen oder Anästhesisten im Bereich der Lendenwirbelsäule durchgeführt und ermöglicht eine weitgehende Schmerzfreiheit unter der Geburt. Doch die Sicherheit steht und fällt mit einer fachgerechten Durchführung, der genauen Beachtung anatomischer Gegebenheiten und einer lückenlosen Überwachung.
Gerade bei erschwerten Bedingungen, etwa bei übergewichtigen Patientinnen, skoliotischer Wirbelsäule oder bereits bestehenden Rückenproblemen, steigt das Risiko für Fehler. Auch Zeitdruck oder mangelnde Erfahrung des medizinischen Personals erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen. Hinzu kommt die Frage, ob die Indikation korrekt gestellt und mögliche Kontraindikationen (etwa Gerinnungsstörungen oder Infektionen im Punktionsbereich) berücksichtigt wurden. Ein Fehler bereits in diesem Stadium kann haftungsrechtlich erheblich sein.
Aufklärung ist Pflicht
Vor der Durchführung der PDA ist eine umfassende Aufklärung zwingend erforderlich. Dabei reicht es nicht, lediglich über die Schmerzlinderung zu sprechen. Vielmehr muss die Patientin über alle relevanten Risiken und möglichen Komplikationen informiert werden, darunter:
- Technische Komplikationen wie Fehllage des Katheters, Fehllokalisation oder eine versehentliche Duraperforation
- Neurologische Komplikationen, etwa Nervenschäden oder Schäden am Rückenmark
- Kardiovaskuläre Reaktionen, wie Blutdruckabfälle oder Kreislaufprobleme
- Infektiöse Komplikationen wie eine spinale Abszessbildung oder Meningitis
- Spinale Hämatome, die durch Gefäßverletzungen entstehen und auf das Rückenmark drücken können
Diese Risiken sind zwar selten, aber sie sind bekannt und müssen daher in die Risikoaufklärung einbezogen werden. Eine unvollständige Aufklärung kann zur Unwirksamkeit der Einwilligung führen. Besonders in Akutsituationen stellen sich Fragen nach der Notfallaufklärung, wie etwa nach der Aufklärung bei Sectio, wenn ein sekundärer Kaiserschnitt notwendig wird. Auch wenn weniger Zeit zur Verfügung steht, darf der Hinweis auf die wesentlichen Risiken nicht unterbleiben.
Warnzeichen nicht ignorieren: wenn Beschwerden auf eine Komplikation hinweisen
Treten nach der PDA Beschwerden auf, etwa Sensibilitätsstörungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder neurologische Ausfälle, muss diesen unbedingt nachgegangen werden. Zu häufig werden Symptome vorschnell als „normal“ nach einer PDA abgetan. Dabei können sie auf schwerwiegende Komplikationen hinweisen, die eine sofortige medizinische Abklärung erfordern.
Hydrocephalus: seltene, aber ernste Folge einer Duraperforation
Bei einer PDA wird eine feine Nadel in den Bereich rund um das Rückenmark eingeführt, um dort ein Betäubungsmittel zu geben. Dabei kann es zu einer sogenannten Duraperforation kommen, bei der die Nadel versehentlich die dünne Hülle verletzt, die das Rückenmark und die Rückenmarksflüssigkeit (Liquor) umschließt.
In der Folge kann Flüssigkeit austreten. Das zeigt sich häufig durch starke, anhaltende Kopfschmerzen, manchmal auch begleitet von Übelkeit, Nackensteifigkeit oder Schwindel. In den allermeisten Fällen werden solche Beschwerden erkannt und die Duraperforation entsprechend behandelt.
Wird die Duraperforation jedoch nicht bemerkt oder bleibt der Flüssigkeitsverlust bestehen, kann das Gleichgewicht des Hirndrucks gestört werden. In seltenen Ausnahmefällen entwickelt sich daraus ein sogenannter Hydrocephalus, bei dem sich Flüssigkeit in den Hirnkammern staut. Das ist eine ernste Komplikation, die sofort durch bildgebende Verfahren (MRT, CT) untersucht werden muss.
Typische Warnzeichen, die niemals ignoriert werden dürfen, sind:
- heftige Kopfschmerzen (besonders im Stehen, im Liegen abnehmend),
- Übelkeit und Erbrechen,
- Nackensteifigkeit,
- Sehstörungen oder neurologische Ausfälle.
In solchen Fällen muss eine sofortige ärztliche Abklärung erfolgen, um gefährliche Folgeschäden zu verhindern.
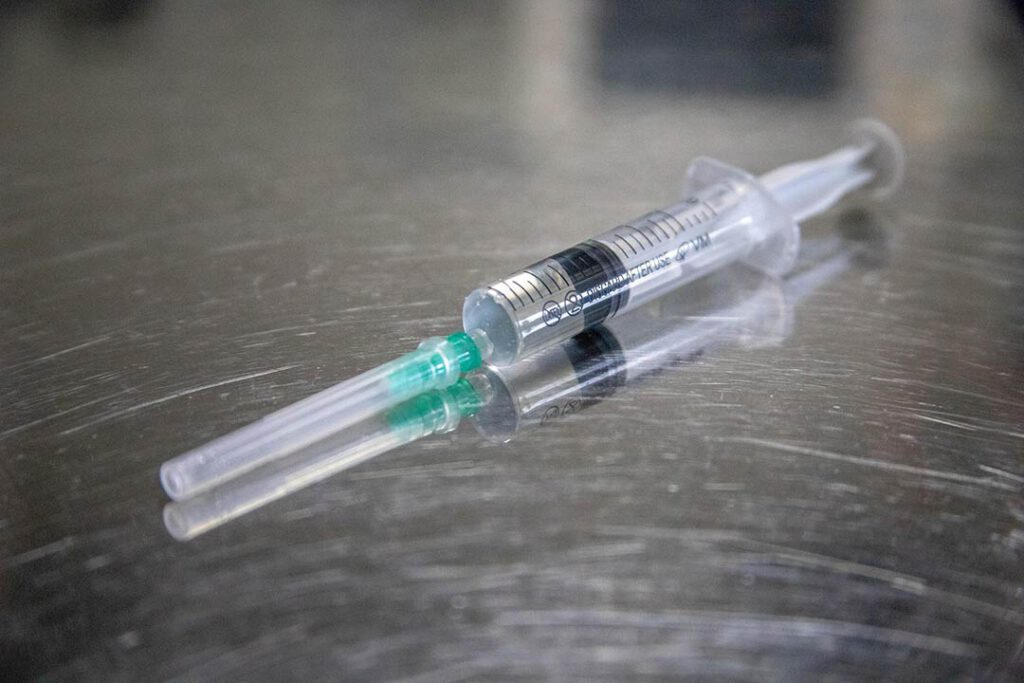
Querschnittslähmung: ein neurologischer Notfall
Eine extrem seltene, aber umso gravierendere Komplikation ist die Querschnittslähmung nach einer PDA. Ursache können Hämatome im Spinalkanal, Abszesse oder direkte Nervenschädigungen sein. Entscheidend ist die rasche Reaktion. Schon bei ersten Warnzeichen wie Lähmungserscheinungen, Blasen- oder Mastdarmstörungen oder Gefühlsstörungen in den Beinen muss eine sofortige ärztliche Untersuchung erfolgen.
Nur durch eine schnelle Bildgebung und gegebenenfalls eine neurochirurgische Intervention kann verhindert werden, dass es zu irreversiblen Nervenschäden kommt. Verzögerungen bei der Reaktion auf Frühwarnzeichen gelten haftungsrechtlich regelmäßig als schwerwiegender Behandlungsfehler. Hier zeigt sich auch die Bedeutung der Nachsorge. Eine engmaschige neurologische Überwachung nach PDA-Anlage ist rechtlich geboten und darf nicht unterbleiben.
Dokumentation und Anästhesieprotokoll: Was zählt im Haftungsfall?
Im Haftungsfall rückt eine Frage besonders in den Fokus: Was wurde dokumentiert und was nicht? Insbesondere das Anästhesieprotokoll spielt bei der rechtlichen Beurteilung eine zentrale Rolle. Hier muss nachvollziehbar festgehalten sein,
- ob die PDA-Anlage erschwert war,
- wie viele Versuche erforderlich waren,
- ob es zu einem Knochenkontakt oder einem Austritt von Liquor kam und
- ob sonstige Komplikationen auftraten.
Auch wann erstmals neurologische Symptome dokumentiert und wie medizinisch darauf reagiert wurde, ist relevant. Fehlt eine dieser Angaben oder ist die Dokumentation lückenhaft, greift § 630h Abs. 3 BGB. Danach gilt, dass eine medizinisch gebotene Maßnahme als nicht durchgeführt erachtet wird, sofern sie nicht dokumentiert wurde. Die Folge ist eine Beweislastumkehr zugunsten der Patientin und damit eine erhebliche haftungsrechtliche Verschärfung für das behandelnde Team.
Zusätzlich spielt die Frage der Organisation eine Rolle. War genügend erfahrenes Fachpersonal anwesend? Wurde die Durchführung ausreichend überwacht oder einem unerfahrenen Arzt ohne Supervision überlassen, kann dies als Organisationsverschulden oder Aufsichtsfehler der Klinik gewertet werden. Ebenso relevant ist, ob bei neurologischen Auffälligkeiten rechtzeitig ein Facharzt – etwa ein Neurologe – hinzugezogen wurde. Unterlassungen in dieser Hinsicht können die Haftung verschärfen.
Beschwerden ernst nehmen und nicht bagatellisieren
In der Praxis werden leider häufig Beschwerden der Patientin nicht ernst genommen. Schmerzen im Rücken? „Normal nach einer PDA.“ Taube Beine? „Das geht schon vorbei.“ Doch dieses Abwarten kann zu spät sein. So erging es auch einer Mutter, die nach der Geburt zunächst keinen Urin lassen konnte und deren Beschwerden als „normal“ abgetan wurden. Später litt sie dauerhaft unter Harndrang und Stuhlinkontinenz. Ursache war eine überdosierte PDA, die dazu führte, dass sie von der Brust ab gelähmt war und die Geburt nicht aktiv unterstützen konnte. Dadurch kam es zu einer Zangengeburt, bei der schwere Beckenbodenschäden entstanden. Im Ergebnis erhielt die Frau in einem Vergleich mit der Geburtsklinik ein Schmerzensgeld in erheblicher Höhe.
Insbesondere in der unmittelbaren Zeit nach der PDA-Anlage ist eine aufmerksame Beobachtung der neurologischen Funktion erforderlich. Jede Abweichung vom Normalbefund muss dokumentiert und abgeklärt werden. Unterbleibt dies, liegt nicht nur ein medizinisches Versäumnis, sondern oft auch ein haftungsrechtlich relevanter Fehler vor.
Wenn aus Schmerzlinderung schwerwiegende Folgen werden
Fehler bei der PDA sind selten, aber dennoch folgenreich. Werden Warnzeichen nicht beachtet oder auf Beschwerden zu spät reagiert, können Patientinnen dauerhafte Schäden erleiden. Die juristischen Anforderungen sind eindeutig: fachgerechte Durchführung, vollständige Aufklärung, lückenlose Dokumentation, angemessene Nachsorge und klare organisatorische Verantwortung in der Klinik. Nur so lassen sich Haftungsfälle vermeiden.
Haben Sie nach einer PDA gesundheitliche Probleme entwickelt oder den Verdacht auf einen Behandlungsfehler? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Die Rechtsanwälte von BROCKS Medizinrecht sind als Patientenanwälte auf Arzthaftungsrecht und geburtshilfliche Behandlungsfehler spezialisiert. Wir prüfen Ihre Ansprüche, fachlich fundiert und mit dem nötigen Gespür für Ihre persönliche Situation.

